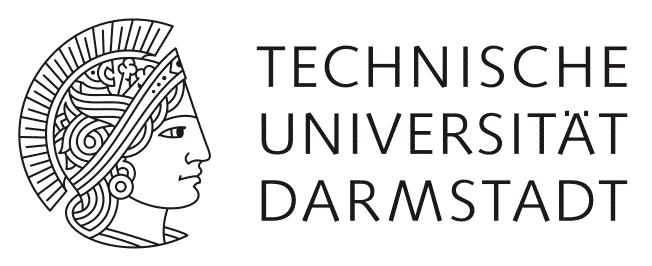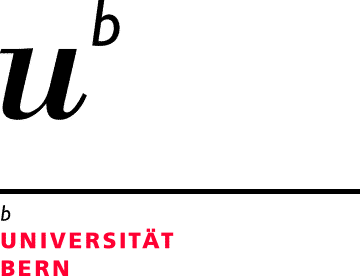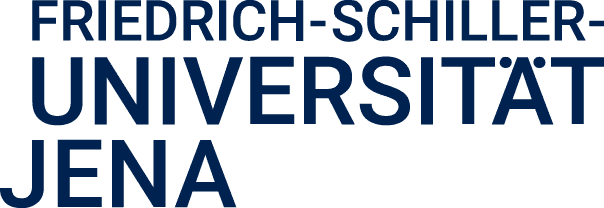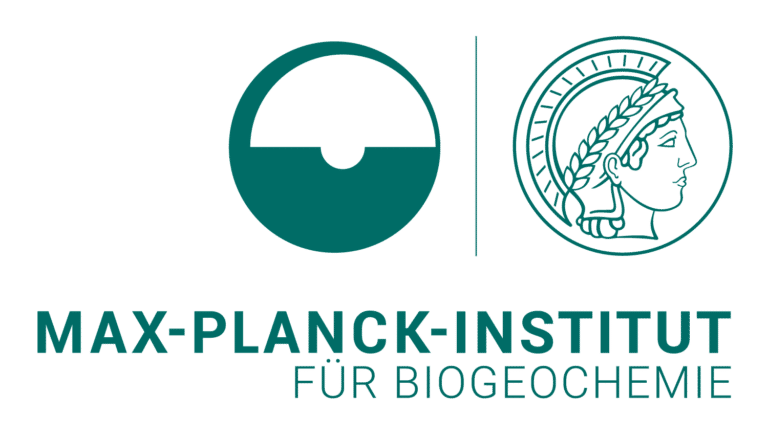Kurzgefasst
Vielfältige Ökosystemleistungen brauchen Artenvielfalt auf verschiedenen räumlichen Ebenen

Diese Studie, veröffentlicht in Nature Ecology & Evolution, untersucht, wie Biodiversität auf unterschiedlichen räumlichen Ebenen zur Bereitstellung von Ökosystemleistungen in europäischen Agrarlandschaften beiträgt – insbesondere in Grünlandflächen. Die Forschenden analysierten Daten aus 150 Versuchsflächen in verschiedenen Landschaften und betrachteten dabei 16 unterschiedliche Ökosystemleistungen – von kulturellen Leistungen (z. B. Möglichkeiten zur Vogelbeobachtung) über regulierende (z. B. Bestäubung, Bodengesundheit) bis hin zu versorgenden Leistungen (z. B. Futtermittelproduktion).
Das zentrale Ergebnis: Die Artenvielfalt auf der Fläche selbst und in der Umgebung (benachbarte Felder und gesamte Landschaft) spielt eine wichtige Rolle – besonders für kulturelle und oberirdische regulierende Leistungen. Im Gegensatz dazu werden versorgende und bodenbezogene Leistungen stärker durch Landnutzung und Umweltfaktoren beeinflusst, z. B. durch den pH-Wert oder die Bodenfeuchtigkeit.
Die Studie zeigt außerdem, dass artenreiche Landschaften ein breiteres Spektrum an Ökosystemleistungen bieten, von denen verschiedene Gruppen vor Ort – wie Landwirt:innen, Tourist:innen und Naturschützer:innen – profitieren. Die Autor:innen betonen, dass Schutzmaßnahmen Biodiversität auf mehreren räumlichen Ebenen berücksichtigen sollten, um die Funktionalität der Natur langfristig zu sichern und die Landwirtschaft nachhaltig zu gestalten.
- Wie wichtig ist Biodiversität für die Bereitstellung unterschiedlicher Ökosystemleistungen in Agrarlandschaften?
→ Die Studie fragt, ob eine größere Pflanzenvielfalt dabei hilft, Leistungen wie Bestäubung, Nahrungsmittelproduktion, Bodengesundheit oder Naturerleben zu fördern. - Spielt die Biodiversität in der umliegenden Landschaft eine Rolle – oder reicht die Vielfalt auf der eigenen Fläche aus?
→ Die Forschenden wollten wissen, ob nur die Pflanzen auf einem einzelnen Feld entscheidend sind oder ob auch die Umgebung eine wichtige Rolle spielt. - Welche Ökosystemleistungen profitieren besonders stark von Biodiversität – und auf welcher räumlichen Ebene?
→ Es wurde untersucht, ob z. B. kulturelle Leistungen (Naturerleben), regulierende Leistungen (Schädlingskontrolle) oder versorgende Leistungen (Futter) eher durch lokale oder durch landschaftsweite Biodiversität beeinflusst werden. - Wie wirken Landnutzung und Umweltfaktoren mit der Biodiversität zusammen?
→ Auch der Einfluss von Bewirtschaftung (z. B. Düngung, Mahd) und Umweltbedingungen wurde berücksichtigt, um besser zu verstehen, wie diese die Bedeutung von Biodiversität mitbestimmen. - Profitieren unterschiedliche Interessengruppen unterschiedlich von Biodiversität?
→ Schließlich untersuchte die Studie, ob verschiedene Gruppen (Landwirtschaft, Bevölkerung, Naturschutz, Tourismus) unterschiedliche Leistungen als wichtig erachten – und wie Biodiversität diese unterstützt.
Die Studie wurde in den drei Forschungsregionen der Biodiversitäts Exploratorien durchgeführt: der Schwäbischen Alb, Hainich-Dün und Schorfheide-Chorin. Diese Gebiete unterscheiden sich in Klima, Landschaftsstruktur und landwirtschaftlicher Nutzung.
Es wurden 150 Grünlandflächen (jeweils 50 × 50 Meter groß) ausgewählt, die von naturnah bis intensiv bewirtschaftet reichten. Die Datenerhebung erfolgte zwischen 2008 und 2018.
Die Biodiversität wurde auf drei Ebenen erfasst:
- Lokal (auf der Fläche selbst),
- im direkten Umfeld (Umkreis von 75 m)
- und auf Landschaftsebene (1.000 m Umkreis).
Gemessen wurde die Artenvielfalt sowie Unterschiede in der Artenzusammensetzung zwischen benachbarten Flächen.
Die 16 untersuchten Ökosystemleistungen wurden vier Gruppen zugeordnet:
- Kulturelle Leistungen (z. B. Vogelvielfalt, Klangvielfalt),
- Regulierende Leistungen (z. B. Bestäubung, Schädlingskontrolle, Bodengesundheit),
- Versorgende Leistungen (z. B. Futtermenge und -qualität),
- Bodenbezogene Leistungen (z. B. Wasserspeicherung, Kohlenstoffbindung).
Zur Auswertung nutzte das Team Strukturgleichungsmodelle (SEM), mit denen sich komplexe Zusammenhänge untersuchen lassen. Zudem wurden Interviews mit lokalen Akteur:innen durchgeführt – etwa mit Landwirt:innen, Naturschützer:innen und Vertreter:innen des Tourismus –, um herauszufinden, welche Leistungen ihnen besonders wichtig sind. Auch Umweltfaktoren wie Boden-pH, Feuchtigkeit und die historische Nutzung wurden berücksichtigt.
Die Studie zeigt: Artenvielfalt auf verschiedenen räumlichen Ebenen – von einzelnen Flächen bis hin zur gesamten Landschaft – ist entscheidend für das Funktionieren vieler Ökosystemleistungen in Grünlandlandschaften.
- Pflanzenvielfalt ist entscheidend:
Eine hohe Artenvielfalt unterstützt besonders kulturelle Leistungen (z. B. Blütenreichtum, Vogelvielfalt) und oberirdische regulierende Leistungen (z. B. Bestäubung, Schädlingskontrolle). - Größere Skala, größere Wirkung:
Die Biodiversität auf einer Fläche allein reicht nicht aus. Auch die Vielfalt in der näheren Umgebung (75 m) und der Landschaft (1.000 m) spielt eine wichtige Rolle – besonders für Leistungen, die verschiedenen Gruppen wichtig sind. - Nicht alle Leistungen reagieren gleich:
Während kulturelle und regulierende Leistungen stark von Biodiversität profitieren, hängen versorgende Leistungen (z. B. Futterproduktion) und bodenbezogene Leistungen (z. B. Kohlenstoffspeicherung) stärker von Umweltbedingungen und Landnutzung ab. - Unterschiedliche Gruppen profitieren unterschiedlich:
Landwirt:innen, Naturschützer:innen, Tourist:innen und Anwohnende legen jeweils auf andere Leistungen Wert. Vielfältige Landschaften können diesen unterschiedlichen Bedürfnissen besser gerecht werden.
Die Forschenden untersuchten zwei Aspekte:
- γ-Diversität (die Gesamtanzahl der Arten im gesamten Umfeld)
- β-Diversität (wie stark sich die Arten zwischen benachbarten Flächen unterscheiden).
Es wurde getestet, ob diese Vielfalt direkt die Ökosystemleistungen beeinflusst oder indirekt, indem sie die Artenvielfalt direkt auf der Fläche (α-Diversität) verändert.
Teil a zeigt ein vereinfachtes Wirkungsmodell, Teil b die tatsächlichen Ergebnisse für kulturelle, regulierende, versorgende und bodenbezogene Leistungen.
- Artenvielfalt ist auf allen Ebenen wichtig.
Damit Grünlandflächen viele Leistungen erbringen können – etwa Bestäubung, Bodengesundheit, schöne Landschaften und Futterproduktion – muss Pflanzenvielfalt sowohl auf der Fläche selbst als auch in der Umgebung erhalten bleiben. - Vielfältige Landschaften erfüllen viele Bedürfnisse.
Landwirt:innen achten z. B. auf Futterproduktion, Naturschützer:innen auf Artenschutz, Tourist:innen auf Blütenreichtum. Landschaften mit unterschiedlichen Lebensräumen können all diesen Ansprüchen besser gerecht werden als eintönige Flächen. - Intensive und extensive Bewirtschaftung können sich ergänzen.
Intensiv genutzte Flächen sind effizient in der Produktion, während wenig genutzte oder dauerhaft ungestörte Grünlandflächen viele andere Leistungen erbringen. Eine gute Mischung hilft, Zielkonflikte zu vermeiden. - Dauergrünland ist besonders wertvoll.
Langfristig ungestörte Grünlandflächen fördern die Biodiversität und bieten stabile Leistungen für Boden, Klima und Tierwelt. - Planung und Politik müssen in Landschaftsdimensionen denken.
Landnutzung und Naturschutz sollten nicht nur auf einzelne Felder schauen, sondern auf die Vernetzung ganzer Landschaften.
Die Studie zeigt, dass der Schutz und die Förderung von Biodiversität auf mehreren Ebenen die Bereitstellung wichtiger Ökosystemleistungen verbessert.
Konkret bedeutet das:
- Landwirt:innen können profitieren, wenn sie kleine, artenreiche Bereiche neben intensiv genutzten Flächen erhalten – zum Beispiel für Bestäuber, gesunde Böden und nachhaltige Produktion.
- Naturschützer:innen sollten nicht nur auf einzelne Schutzgebiete setzen, sondern ganze, artenreiche Landschaften fördern, die sowohl Wildtiere als auch Landwirtschaft unterstützen.
- Politik kann Agrarförderungen so gestalten, dass sie den Erhalt von Biodiversität auf Landschaftsebene belohnen – nicht nur auf einzelnen Feldern.
- Regionale Gemeinschaften und Tourismus profitieren von Landschaften, die schöner, artenreicher und besser für Klima- und Wasserschutz sind.
Insgesamt spricht die Studie für einen integrierten Landschaftsansatz: Felder, ihre Umgebung und die gesamte Landschaft sollten gemeinsam geplant und bewirtschaftet werden – damit Ernährung, Naturschutz und das Wohl der Menschen in Einklang gebracht werden können.